Kataloge
Keramocringe
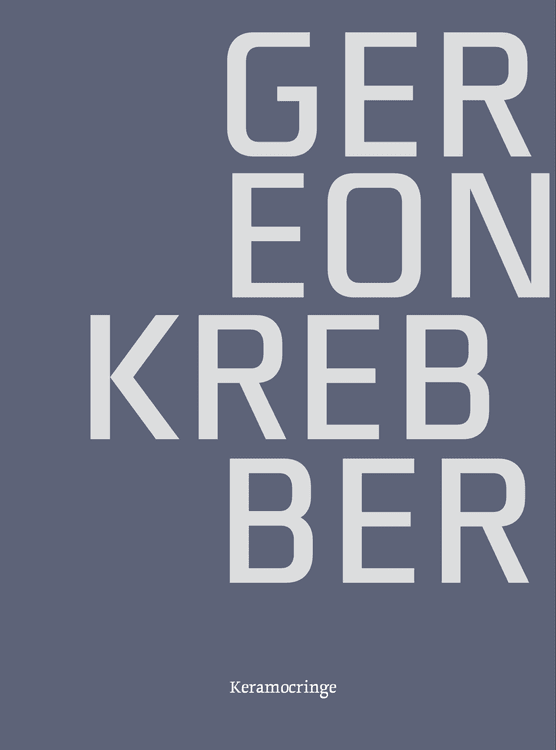
Gereon Krebber – Skulpturensammlung Viersen

antagomorph

Gereon Krebber – Kunstraum am Limes
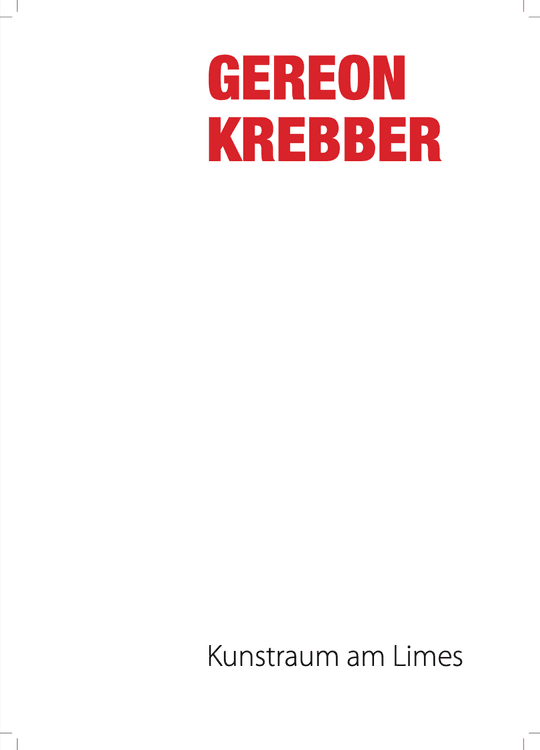
Here today, gone tomorrow

Azurkomplex
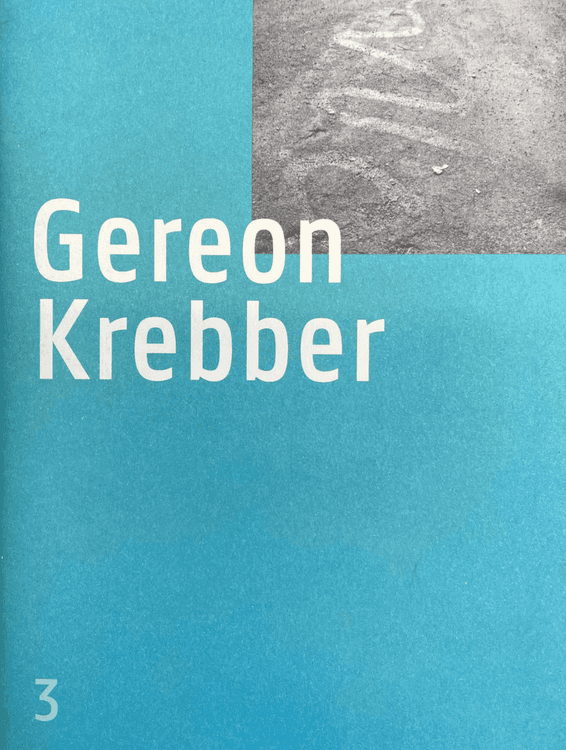
Sorrysorrysorry

All that is solid melts into air

Arbeiten nach Größe

Videos
Konspirative KüchenKonzerte #26: Gereon Krebber & das Gemüseorchester
One After The Other – Sequential Micks
Interview – Lagelagelage
Interviews
Keramocringe
Keramocringe ist die letzte Ausstellung an diesem besonderen Ort: Nach 40 Jahren schließt das Skulpturenmuseum Glaskasten Marl seine Räume am Creiler Platz – mit einer Schau von Gereon Krebber. Da die Sammlung schon im letzten Sommer ins Depot gebracht wurde, sind die Räume unterhalb des Marler Rathauses das erste Mal seit langer Zeit frei. Ebenerdig, rundum verglast und mit durchgängigem...
Texte
Dem Pathos der Alten die Luft rauslassen – Gereon Krebbers „Myreen“
Guido Reuter (Kunstakademie Düsseldorf)

Gereon Krebbers „Myreen“ ist fantasiereich, humorvoll und verdeutlicht den Anspruch des Künstlers, traditionelle Aspekte skulpturaler Bildwerke in seine Arbeit so zu integrieren, dass sie künstlerisch zugleich gegen den Strich gebürstet werden. Dieses Vorgehen kann auf Seiten der Rezipient*innen jedoch die Wahrnehmung wie das daraus folgende Verständnis des dreidimensionalen Bildwerks erschweren – insbesondere, wenn die Betrachtenden weniger vertraut sind mit dem...
„Geh lieber Ton kneten …“
Maria Müller-Schareck

Was für eine Mischung! Die Liste der unterschiedlichen Materialien, die Gereon Krebber für seine Skulpturen verwendet, liest sich wie ein Einkaufszettel für den Baumarkt, verbunden mit einem Abstecher in den Supermarkt: Bauschaum, Beton, Bitumen, Cola, Folie, Gelatine, Gips, Glyzerin, Holz, Kabelbinder, Kartons, Klebeband, Kleiderbügel, Kordel, Lack, Leim, Luftballons, Mayonnaise, Polyester, Putz, Styropor, Süßigkeiten, Teppich, Trockenfleisch, Verbundglas, Wachs, Wellrohre, Zucker, Pigmente...
Die Verschiebungsleistung der Skulptur. Gereon Krebber
Peter Lodermeyer

Taubenabwehr, Klebstoff, Nylon, Marihuana, Folie, Sprühlack, Holz. So lautet die Materialangabe für Gereon Krebbers Skulptur „Lass uns später noch mal drüber reden“ von 2010. Kein Zweifel: Krebber liebt Materialien, die man nicht im Kunstkontext erwartet. Wollte man alle Substanzen aufzählen, die er bereits verwendet hat, käme man auf eine lange Liste – und kaum etwas würde darauf hinweisen,...
Häufig gestellte Fragen
Wegen der Bohne. Eingeladen zu einem Kunst-am-Bau-Wettbewerb, habe ich für das Biozentrum der Universität zu Köln eine Skulptur entwickelt. Die zweiteilige Skulptur reicht 16 Meter hoch über mehrere Etagen des Gebäudes und ist meine bisher größte Arbeit (Abb. S. 52 ff.). Sie ist in Einzelteilen gefertigt und vor Ort zusammengefügt worden. Um die Skulptur bauen zu können, brauchte ich viel Atelierplatz und konnte mir in London schlicht kein Atelier leisten, das groß genug gewesen wäre – von den Unsummen für den Transport ganz abgesehen. Hier in Köln war das alles einfacher möglich. Daher bin ich zusammen mit meiner Familie umgezogen – und dann hier hängengeblieben. Jetzt ist noch das Wilhelm-Lehmbruck-Stipendium dazugekommen, in dessen Rahmen ich für XL-Projekte ein Riesenatelier in Duisburg nutzen kann. Die Produktionsbedingungen sind gerade ausgezeichnet.
Ja, ich bin in Bottrop aufgewachsen, einer kleinen Stadt im Ruhrgebiet. Wo früher mal Zechen waren, gibt es heute Gartenzäune, Stretchhosen und Autotuning. Und eben das bekannte „Quadrat“, das Josef-Albers-Museum, der kulturelle Stolz der Stadt. Das war eine Art Reservat, entscheidend für meine künstlerische Früherziehung. In Bottrop gab es für mich das geistige Abenteuer von Kunst und Wahrnehmung gleich nebenan im Stadtgarten.
Ich finde es überwältigend, selber, mit eigenen Mitteln und Ideen etwas zu schaffen, das existiert und vor einem steht. Es ist, als ob man in einen Klumpen Leben hinein bläst, fast so wie beim alten Pygmalion. Nach dem Abitur habe ich mich unter den Kastanienbaum vor der Schule gesetzt und mich entschlossen: Dafür werde ich meine Jugend verschwenden – und den Rest meines Lebens gleich mit. Das musste aber erst einmal durchgeboxt werden. Es war mir nicht von vornherein klar, Künstler zu werden. Ich hätte meine manuellen Obsessionen und leptosomen Feinfühligkeiten gern auch als Zahnarzt ausgelebt, oder meinen intellektuellen Exhibitionismus als Journalist heraushängen lassen. Aber ich hatte schon anderweitig Blut geleckt, mich schulisch wie außerschulisch an Speckstein, Ton und Tusche ausprobieren dürfen Glück gehabt; Künstler zu werden, war die wahrscheinlich sozialverträglichere Wahl.
Ja, ich habe vor meinem Studium sogar viel Akt gezeichnet, bin auf den Schlachthof gegangen und habe Fleischberge, Schimmelkolonien und Plastikpuppen in Tüten fotografiert. Das klingt jetzt vielleicht etwas peinlich, aber ich hatte einen etwas postpubertären Hang zu Fleisch, Haut und Schleim. Diese Momente zwischen unterschwelligem Ekel und nervöser Faszination waren und sind eindringlich. Über eine längere Zeit habe ich zum Beispiel eine tote Maus gezeichnet, die ich im Eisfach aufbewahrte und zum Zeichnen immer wieder herausnahm – bis der Geruch wirklich nicht mehr zu ertragen war. Ich habe mich zuerst auch im Malen versucht, aber ich komme mit Farben nicht klar. Zu bildlich, zu flächig, zu wenig Widerstand. Ich kann es nicht, aber ich kann es auch nicht lassen. Deshalb benutze ich noch immer Farbe in meinen Arbeiten, als Material, als eine Art Haut, die ich wie Suppe darüberschütte, als zähe Emulsion hinab fließen lasse oder als Nebel versprühe. Ich zeichne auch nach wie vor, so auch die kleinen Lagepläne für diesen Katalog. Die freien Zeichnungen dagegen sind in letzter Zeit etwas ins Hintertreffen geraten. Da muss ich jetzt wieder ran.
Bildhauerei ist eigentlich unsäglich schwerfällig, materialverliebt und mühselig. Es gibt immer Ärger mit der Schwerkraft; es ist und bleibt eine Pein mit der Physis und am Ende stolpert immer einer drüber. Aber es ist gerade das Körperliche, das unmittelbar Präsente, die Epiphanie im Material, die mich nicht loslässt. Ich brauche den greifbaren Körper, das Haptische vor mir. Das habe ich zuerst an der Kunstakademie in Düsseldorf gemerkt, als man mir im Orientierungsbereich einen Sack Gips hinstellte und ich die dritte Dimension für mich entdeckte. Anfangs habe ich mit Papiermaschee, Gips und Pappe einfach Objekte nachgebaut: Ein paar Ziegelsteine aus Pappe oder ein Krokodil aus einem Haufen Abfall. Schrittweise konnte ich mir eine plastische Sprache aneignen, geprägt von den biomorphen Formfindungen und Materialvirtuositäten von Tony Cragg und den Architekturmonolithen und archetypischen Setzungen von Hubert Kiecol. In deren Klassen habe ich mein plastisches ABC gelernt.
Schon zu Studienzeiten benutzte ich Ton, Gips, Klebeband, Pappe und allen Krams, der mir in die Finger fiel. Aber ich lavierte umher, lenkte mich ab, kam nicht zu einer einheitlichen, klar lesbaren Formulierung: Du musst Dich entscheiden, hieß es. Ich entdeckte, dass es gerade dieser Zwiespalt ist, der mich selbst antreibt und den ich brisant finde. Und dass ich dem Betrachter ein solches Dilemma als Erfahrungsmoment zumuten will: Immateriell und massiv, präsent und absent, transparent und opak zugleich. Zwischen körperlicher Greifbarkeit und bildhafter Erscheinung entsteht eine Spannung, die einen auf sich selbst zurückwirft. Um diese Ambivalenz als Thema zu entdecken, dafür musste ich aber erst nach London gehen. Dort konnte ich dann meine Arbeit thematisch schärfen und prekäre Materialien wie Folie und Gelatine einbringen.
ch arbeite nach wie vor mit einem breiten Spektrum an Materialien, die häufig aus dem Alltagsgebrauch entlehnt sind. In Drogheda benutzte ich Holz, Trockenfleisch, Bauschaum, Beton, Cola, Wellrohr, Bitumen, Klebeband, Sprühfarbe, Gips, Holzwolle, Farbe, Löcher in der Wand – eine wilde Mischung. Meist finde ich Gefallen an einem bestimmten Material, weil ich damit bestimmte körperhafte Erfahrungen vermitteln und es gleichzeitig zu einer Erscheinung animieren kann, die verwundert. Zum Beispiel Gelatine, also gemahlene Kuh, ergibt mit Glyzerin und Wasser eine Mischung, die nach dem Erhärten etwa die gleiche Konsistenz besitzt wie der eigene Körper. Sie ist zäh, weich und leicht schwabbelig, aber dennoch entschieden künstlich.
Die Materialien selbst sind bei mir meist erst auf den zweiten Blick zu erkennen, manchmal sogar kaum voneinander zu unterscheiden. Häufig nutze ich ein Holzgestell oder einen Unterkörper aus Styropor und trage andere Materialien dann schichtweise wie eine Haut auf. Das betreibe ich bis zu einem extremen, leicht pervertierten Punkt, an dem sie – die Stoffe – zeigen, was sie können, aber sonst meist nicht dürfen. Verschmolzen, verbrannt, dick aufgetragen, übermodelliert, gegossen, verspachtelt, geschliffen, geraspelt oder besprüht suche ich eine neue, überraschende Qualität, die auf den ersten Blick wie aus sich selbst entstanden wirkt. Häufig täusche ich dafür Aggregate vor, Beulen, Deformationen, Dehnen, Knicken und Stauchen. Das wirkt, als wäre das Objekt in einem Prozess befindlich oder unter Druck geraten. Diese falschen Fährten verrätseln das Material zusätzlich. Das Übercodieren gewöhnlicher Eigenschaften verunsichert: Es ist ein Spiel, bei dem man seinen Augen nicht trauen kann.
Manche Arbeiten wirken, als stünde ihnen ein Schicksal als Sondermüll bevor. Doch meist sehen sie giftiger aus, als sie sind. Ich gestehe zwar, schon meine Freude an Gift zu habe – doch lieber nur visuell. Mir ist bei einer Transportfahrt mal eine Ladung Rattengift in den Schoß gekippt, die ich als Puderschicht für Skulpturen benutzt habe. Ich war über und über mit dem bläulichen Pulver eingenebelt, es klebte überall. Das endete bettlägerig-glimpflich und hat mir an Giftspielchen erst einmal gereicht; diese Sturm- und Karzinogenzeit ist vorbei. Heute nehme ich Acrylharz statt Polyester, Acryl statt Nitroverdünnung; das ist umweltfreundlicher und belastet mich selbst auch weniger. Doch nicht ganz: Meine tägliche Dosis gebe ich mir noch heute – in der Herstellung und Verarbeitung. Rauch, Sprühnebel, schmelzendes und sengendes Plastik, Tulole, Styrole, Bitumen, Glasfasern und Zementstaub sind alle nicht gesundheitsförderlich. Im fertigen Objekt später sind all diese Materialien dann gebunden, harmlos und meist stubenrein ¬− in der Verarbeitung aber sieht das anders aus. Staub, Schmutz, Lösungsmittel: Schnell die Maske auf, Handschuhe an und es kann losgehen − was man nicht alles tut für seine Kunst.
Vielleicht ist es ein bestimmter Zwiespalt, der mich selber treibt. Mich fasziniert das, was anderen peinlich ist, was eben körperlich stattfindet und was sich materiell wie ein Schicksal niederschlägt. Es geht mir um Phänomene, die physisch wie psychisch wirken und denen ich habhaft werden will. In meiner bildnerischen Sprache baue ich ein Spannungsfeld zwischen Körper, Material und Erscheinung auf. Die treibende Kraft steckt zwischen dem Körper-Sein und Körper-Haben. Abgesehen von meiner Hobbyanthropologie und Privatobsession – von da aus ist es noch ein langer Weg zu den Chimären, die meine Ausstellungen bevölkern. Aber es erklärt, warum vieles so unintellektuell direkt und sinnlich funktioniert. Es sind die Säfte, die hier sprechen.
Mir geht es um Verschiebungen, Vereinfachungen und Transformationen. Formen, vormals erkennbar und in hohem Maße gegenständliche Assoziationen weckend, lassen sich nicht mehr konkret zuordnen. Es gibt zwar prägnante Details, an denen sich unsere Erfahrung und Erinnerung orientieren können, doch die Arbeiten erhalten etwas von Scheinbildern, die einem wie nasse Seifenstücke aus der Hand gleiten. Manche wirken tatsächlich wie Readymades oder gefundene Objekte; so zum Beispiel Verbrannter Stall. Meist sind sie jedoch aufwendig gebaut, bearbeitet und verändert, damit sie die gewünschte Präsenz erhalten. Das ist vergleichbar zu dem, was in Träumen und Witzen passiert, wenn Übersehenes oder Verdrängtes sich vermischt, unkenntlich wird und als Kurzschluss neu und überraschend ans Tageslicht drängt, so wie sich Latentes im Traum manifestiert, soll es sich als Objekt zeigen: Es ist da – und das ist das Problem.
So verschieden meine Skulpturen aussehen: Sie sind Fremdkörper mit einem Hang ins Groteske, vielleicht etwas komisch und leicht transgressiv. Sie haben etwas suggestiv Abweichendes an sich: Als könnten sie peinlicherweise ihren Körper selbst nicht recht kontrollieren; Haltung und Form weichen auf. Sie scheinen unter der eigenen Last zu einzusacken, die Volumina spannen und wölben sich, meist hängt dummerweise irgendwo noch etwas heraus oder fließt etwas herunter. Viele Arbeiten scheinen wie in einer Metamorphose begriffen; teils bizarr, teils profan, funky oder halb schlaff, überdimensioniert oder fragil, mit Plauze und Anusloch. Als wesenhafte Entitäten wirken sie fantastisch und unwirklich, ganz so, als kämen sie aus einem Film – allerdings findet der Film in den Köpfen der Betrachter statt: Wunderland ist abgebrannt, Frau Holle meets Alien bei den sieben besprühten Zwergen hinter den sieben Bergen auf irgendeinem Wüstenplaneten. Zwischen Sci-Fi-Props, Postminimalismus und Installationitis zeigen sich die Arbeiten als visuell unmittelbar von verführend bis monströs. Es sind ‚misfits‘ und Freigeister, keine klassischen Schönheiten. Als Groteske öffnen sie sich spielerisch für Assoziationen und Körperbezüge – durchaus humorvolle, vielleicht nicht immer angenehme.
Die meisten meiner Skulpturen sind unweigerlich abstrakt; viele spielen mit figuralen Momenten. Es sind keine Körper, die etwas mimetisch darstellen – sie sind eigenständig. Die kleinen blinden Tierbüsten, die ich vor Jahren modelliert habe, machten mir das schlagartig klar. Ich fand sie zu figürlich und handlich, und als ich diese groß bauen wollte, habe ich kurzerhand nur noch das reduzierte Volumen gebaut und bin bei einer einfachen Tonnenform geendet. Solche vereinfachten Körper habe ich gern über Abweichungen und Knicke animiert. Als ich später mit Wolken und Schüttungen anfing, habe ich meine Plastiken aus den Möglichkeiten des Materials und der räumlichen Auseinandersetzung frei entwickelt. Diese Ausdehnungen sind amorph und fordern Projektionen heraus, eine Figur entsteht nur in der Vorstellung. Inzwischen sind es häufig Grenzen, einfache Setzungen und Aggregate in Aktion, die meine plastischen Formen anregen. Im Prozess forme und manipuliere ich sie weiter, damit sie die erwähnte fremdartige Präsenz gewinnen. Ich bediene mich ausgiebig im breiten Sortiment, welches die neuere Kunstgeschichte der Skulptur zu bieten hat. Meine Formensprache ist ein Amalgam aus Modernismen und Minimalismen, aus formalen Etüden und persönliche Attitüden. Meine Haltung ist eklektisch. Jedoch versuche ich, diese Dinge konterintuitiv einzusetzen, also der bisherigen Erfahrung gegenläufig – daher meine Materialkapriolen und disparaten Brüche.
Irgendwann ist der Punkt erreicht, dass es fertig wirkt – oder eben noch nicht. Meine Kunst arbeitet visuell, deshalb ist Gelingen schwer in Worte zu fassen. Ich weiß es manchmal selbst nicht; es fällt mir oft schwer, aufzuhören. Besonders schlimm waren früher die Oberflächen. Eine Arbeit, einen großen Ring aus Aluminium, habe ich solange geschliffen, bis er komplett glatt war und die Nahtstellen eingeblendet waren. Ich war trotzdem nicht zufrieden. Da habe ich die Arbeit abgespachtelt und mühselig eine artifizielle Aluoberfläche erzeugt: Die komplette Oberfläche habe ich wochenlang geschliffen und poliert. Ja, wirklich, ich habe auf einer Aluminiumskulptur künstlich eine Aluoberfläche hergestellt. Damals am College habe ich alle anderen von morgens bis abends mit Staub, Polyester und Schleiflärm genervt. Am Ende wirkte der Ring superglatt und künstlich. Das wollte ich zwar, aber gefallen hat es mir trotzdem nicht. Nach zwei Monaten Plackerei habe ich mir grobes Schleifpapier genommen und ruckzuck alles wieder heruntergeschliffen. So konnte es nicht weitergehen – das Ding war wieder blank und blieb so. Soweit dazu, wann eine Arbeit fertig ist.
Viele Arbeiten baue ich direkt vor Ort – für den Raum, in den Raum hinein. Ich komme mit Sack und Pack in den Ausstellungsraum und lege los, ganz so wie im Atelier auch. Für diese Arbeiten suche ich mir gerne Nischen, Ecken, doppelten Böden, Säulen und Träger. Randständige Plätze, verbaute Situationen und zufällige Momente in der Architektur geben perfekte Ankerpunkte. Einige meiner Arbeiten implantiere ich richtig, gieße sie in den Raum hinein, säge den Fußboden auf oder wickele sie um einen Pfosten. Die Architektur wird Teil und Gegenpart der Arbeit, die fest mit dem umgebenden Raum verwoben ist. Die Präsenz spitzt sich zu, die Sache wird prekär und endet unwiederbringlich im Hier und Jetzt. Das reizt mich daran. Ich reagiere auf Situationen und spiele mit örtlichen Vorgaben, inhaltlich wie formal: Gegebenheiten sind Gelegenheiten, aber bitte kein Bezugslarifari. Von allen meinen Arbeiten verlange ich, dass sie selbstständig funktionieren und sich behaupten. Da sieht man wieder: Ich bin ein erklärter Fan von künstlerischer Autonomie. Natürlich weiß ich, dass dies ein schöner Modernismus ist. Aber ein schöner eben, deshalb gibt es ganz viele unabhängige Arbeiten.
Nicht im konventionellen Sinn. Es geht mir um etwas anderes. Es stimmt zwar, der Ausstellungsraum wird Ort eines imaginären Geschehens, ähnlich einer Bühne. Aber es gibt keine Aufführung. Ich darf es noch mal zusammenfassen: Es manifestiert sich physisch ein Objekt, das auf den ersten Blick schwer zu einzuordnen ist und angenehmerweise als Kunst gilt. Es scheint wie in einer Bewegung eingefroren, in Gestalt und Oberfläche manchmal seltsam, häufig überdimensioniert, zwischen- bis unförmig oder vielleicht wie ein Irrlicht schimmernd. Aus dem Kitzel des Fremdartigen, Peinlichen, Gewaltigen, Täuschenden oder Überraschenden entsteht ein Reiz der Herausforderung. Wenn auch in selbst gewählter Distanz, ist man unmittelbar physisch konfrontiert. Zwischen Neugier und Zögern gewinnt unsere Wahrnehmung schrittweise die Oberhand, erkundet die Oberfläche, erkennt das Material und das Gemachte des Objekts. Das ist befreiend und genugtuend, aber kein Theater mit Katharsis & Co. Der Betrachter muss selbst aktiv werden; der Erfahrungsmoment ist haptisch. Es ist die Lust am Begreifen und der Kick eines Unbekannten – aber kein Theaterstück.
Räume können harte Nüsse sein – so zum Beispiel die Seitengalerie im Lehmbruck Museum. Ein Schlauch von 40 Metern Länge, die Straßenseite ist eine lange Fensterfront, die andere Seite ist eine dunkle Ziegelwand. Eine Schaubühne für das Museum, schwierig zu bespielen. Für mein Projekt dort gab es kein Budget, aber ein Stipendium und vom Direktor die Ansage, bitte einfach zu zeigen, was ich im Atelier gemacht habe. Doch ich überlege mir meine Ausstellungen immer vom Betrachter aus: Zu welcher Erfahrung lade ich den Besucher ein? Was ist gerade – hier − mit meiner Arbeit möglich? Häufig werde ich schon gleich am Eingang handgreiflich und blockiere den freien Zugang. Für das Lehmbruck Museum habe ich Arbeiten eigens entwickelt und gebaut: eine bläulich schimmernde Wandschlange, sekundiert von einem Verbindungsstück und einem Bauschaumkanal. In manchen Ausstellungen zeige ich auch nur eine einzelne Arbeit, die es dann auf den Punkt bringen muss. Für Ausstellungen wie in Drogheda stelle ich einen Parcours aus unterschiedlichen Arbeiten zusammen − quasi einen skulpturalen Hindernislauf. Hier lasse ich wie in einer Raumcollage die unterschiedlichen Materialien, Formate, Formen und Oberflächen aufeinanderprallen. Klein neben groß, glatt neben geknüllt, Loch neben Wandarbeit, Blockade vor Mobile – Räume werden verengt, Sachen gestreut und zusammengezogen, Dinge gegeneinander austariert oder betont. Allzu offenkundigen Bezügen gehe ich lieber aus dem Weg, genauso wie Themenvorgaben und Setzungen wie dem übermächtigen Altar. Das ignoriere ich meist. Zu leicht werden Bezüge erstickend illustrativ und erschweren das aktive Wahrnehmen und Entschlüsseln.
Vita brevis, ars longa: Die Ewigkeit bleibt ein feuchter Künstlertraum. Manche meiner Arbeiten sind ephemer; ihre Tage sind gezählt, sie existieren nur für die Zeit der Ausstellung. Danach ist der Spuk vorbei: „Here today, gone tomorrow“. Manche meiner Materialien vergehen, schrumpeln, verlieren Luft, altern, reißen, vertrocknen und enden als ein Memento mori mit leichtem Hautgout. So wie man sie jetzt – im Moment des Betrachtens − sieht, werden sie nie mehr wieder sein. Friede ihrer Asche, seufz und Amen. Diese Arbeiten sind orts- wie zeitspezifisch, gebunden an die Vorgaben des Ortes und die Haltbarkeit des Materials. Bei Außenarbeiten oder längerfristigen Installationen wie Bohne oder Bob_343 ist das genauso, sie dürfen bloß länger leben. Diese beiden Arbeiten sind innen installiert, das Material ist geschützt vor Wind und Wetter. Das erhöht ihre Lebensdauer und lässt sie nur langsam altern. Die Farben bleichen aus, die Oberflächen werden vielleicht spröde, aber sie lassen sich bei Bedarf auch wieder aufarbeiten und mit einer neuen Schutzschicht überziehen. Spätestens, wenn das Gebäude abgerissen, umgenutzt oder umgebaut wird, ist es auch für sie vorbei. Dann müssen sie weichen oder werden mit untergehen. Architektur ist alles andere als ewig, man rechnet heute mit Nutzungsdauern von Gebäuden von etwa 50 Jahren. Momentan heißt es bei mir eher „viel und vergänglich“ als „wenig und stabil“. Das kann sich auch wieder ändern. Manche Arbeiten sind auch aus Aluminium oder gebranntem Ton, ordentlich widerspenstig und lange haltbar. Vielleicht sollte ich mich mal wieder als Kontrastprogramm richtig zähen Materialien zuwenden. Material, Ort, Zeit, feuchte Träume: Eigentlich will ich bloß gerne die ganze Ewigkeit zu einem Augenblick zusammenfrieren. Und aus dem abgebauten Material baue ich gerne wieder die nächste Arbeit.
Es ist vielleicht schon aufgefallen, wie sich Verfall und Vergänglichkeit in meiner Arbeit breit gemacht haben. Viele der Arbeiten wirken explizit abseitig und sind düsterer als vorherige; einige Ausstellungen sind ein schöner Gruß aus einer Desasterzone. Wenn auch still und statisch, erinnern sie an Untergangsszenarien: Verbranntes Holz, Überreste, die Oberflächen klaffen zerlöchert und aufgeworfen. Diese Versehrtheiten haben die glatt gespannte Folienhaut verdrängt, die wie Plasma schimmerte und doch aus der Küchenschublade stammte. Keine Wolken mehr, kaum Frischhaltefolie, kaum Gelatine. Beide Materialien fehlen völlig in der Ausstellung in Drogheda. Dafür mehr verbranntes Holz, Mobiles mit Schlachtresten und wurmartiges Polyurethan. Die Formen sind insgesamt komplexer, aufgewühlter und pulsierender geworden. Der Humor ist in den Hintergrund getreten, die Melancholie hat mehr Galle bekommen. Ich bin gespannt, wie ich die Arbeiten weiterentwickeln werde.
Die Titel entstehen teils lautmalerisch, teils assoziativ, teils deskriptiv, immer aber erst wenn die Arbeit fertig ist und das Kind einen Namen braucht. Gern starte ich mit einer generischen Objektbezeichnung wie Kissen oder Topf; lakonisch, deadpan und direkt. Viele Arbeiten brauchen jedoch etwas anderes, damit sie auch über die verbale Ebene weitere Verbindungen hervorlocken. Daher nehme ich gerne gängige Floskeln, vor Ort gefundene Worte oder Sprichwörter und wandele sie ab. Ob per Assoziation, Sprachspiel oder Anknüpfung, ich versuche mich mit eigenen Wortfindungen an das Objekt heranzutasten. Ich suche dabei Konnotationen, um die Arbeit zu bereichern. Das Ergebnis wirkt manchmal skurril und unverständlich, manchmal fast banal. Es sind Fingerzeige und Fragezeichen, Fußangeln und Spielbälle − genauso wie die Skulpturen selbst.
Für den Bloomberg Space in London baue ich einen großen verbrannten Bretterwald, einen verkohlten Rest von einem Irrgarten. Es wird ein Katastrophengebiet auf Zeit, das man durchqueren kann, wobei man aber nirgends hingelangt. Ich habe die Segmente einzeln vorgebaut, zerdeppert und abgefackelt. Vor Ort baue ich daraus ein pseudoarchitektonisches Gerippe mit winkligen Ecken und Wänden. Beim Verbrannten Stall im Kunstmuseum Bonn hat mich fasziniert, wie mich der Innenraum beim Betreten eingenommen hat. Diese Immersion, dieses Spiel von innen und außen möchte ich weiterbringen und ein Eintreten und Durchqueren ermöglichen. Anstelle auf den Raum zu reagieren, schaffe ich eine eigene räumliche Situation. Das ist neu für mich, auch wenn ich häufig an der Schnittstelle von Architektur und Skulptur arbeite. Neu ist auch der direkte inhaltliche Bezug. Der Bloomberg Space liegt in London mitten in der City am Finsbury Square. Bloomberg TV ist ein Wirtschaftssender, der sich einen erstklassigen Kunstraum mit einem internationalen Programm leistet. Man sitzt direkt am Herzschlag des globalen Kapitalismus. Darauf reagiere ich mit einer schwarzen Negation, einer Desasterszene, einem Ort ohne Ausweg und Zusammenhalt.
Nein, aber in bestimmten Kontexten kann ich dem nicht widerstehen. Es ist eher so, dass ich dahin will, wo es weh tut − vielleicht hätte ich doch Zahnarzt werden sollen. So beschrieben, klingt die Arbeit für Bloomberg erstmal abschreckend plakativ und platt, da ich eigentlich Sachen eigentlich unbestimmt halten will. Doch das kann leicht zu unverbindlich werden. Ob Körper oder Raum, ich brauche Bezüge, damit Relevanz entsteht. Um mich und uns weiter aus der Reserve zu holen, streife ich das Politische. Ich habe das erstmals bei Let the pigs pay in der Galerie Christian Lethert probiert. Auch die Besucher in Drogheda haben die Ausstellung darauf bezogen, dass der ‚Keltische Tiger’ eine Bauchlandung hingelegt hat. Es bleibt offen, aber wird brisant. Ich will nicht verhehlen, wie ich mit geballter Faust und ratlos hängenden Schultern dastehe. Der moralische Zeigefinger bleibt in der Tasche. Ich habe auch keine schlauen Lösungen oder guten Absichten; die widern mich sowieso an. Wie auch − als Künstler ist man Vorreiter wider Willen, wenn es um Themen wie Globalisierung und Marktwirtschaft geht. Mich fasziniert, wie superkomplexe Systeme und Machtgefüge eine Eigendynamik entfalten, die jeder Kausalität, Kontrolle und Absicht spotten. Die Folgen sind vernichtend und wirken wie ein Schock – und treiben mich dazu, darin herumzustochern.
Gerne da, wo es gutes Programm, kluge Leute, passende Räume, Zeit, eine Portion Risikofreude, große Türen und eine vernünftige Auseinandersetzung gibt. Und d
Ja, aber der Verdienst schwankt stark, plötzlich kommt viel zu viel, dann lange wieder nichts, dann heißt es aushalten und haushalten. Nach Bohne gab es plötzlich einen ungewöhnlich hohen Kontostand, der mich am Bankautomaten neben meinem Atelier erwischte. Das wirkte auf den ersten Blick irreal, hier in Bickendorf zwischen Betonburg, Obdachlosenhilfe und Mega-Erotik-Discount. Egal, ein solcher Auftrag hat mir auf jeden Fall Luft geschaffen für einige weitere Projekte. Meine Sachen baue ich, weil ich sie irgendwo sehen will und ich meine Bildsprache weitertreiben will – bezahlen muss ich die natürlich auch. Die große Arbeit Azurkomplex zum Beispiel war arbeitsaufwendig und teuer. Ich habe sie komplett aus dem Wilhelm-Lehmbruck-Stipendium finanziert: Zuerst kommt die künstlerische Neugier, dann das kunstunternehmerische Kalkül. Die Frage ist, was man macht, wofür man lebt, und nicht allein wovon. Klar muss ich Miete zahlen, Mäuler stopfen und eigene Macken pflegen. Daher habe ich zeitweise weitere Quellen, die mich vor falschen Zwängen schützen – zurzeit verdiene ich mir ein Zubrot als Gastprofessor an der HfbK Hamburg. Aber auch hier steht im Vordergrund, dass es Sinn macht und eine spannende Herausforderung ist. Alles in allem komme ich gut über die Runden, auch wenn die eigenen Sachen vergänglich sind.